Quelle: Süddeutsche Zeitung – Auszüge aus der Rezension von Franziska Augstein – September 2020
Der Historiker und Amerikanist Bernd Greiner zeichnet in einer exzellenten Abhandlung nach, wie Henry Kissinger die US-Außenpolitik von Richard Nixon mitprägte – und wie die beiden im Weißen Haus wüteten.
Als Richard Nixon 1968 Wahlkampf führte, gaben seine Mitarbeiter ihm ein Memorandum mit: Die Vereinigten Staaten seien bisher zu defensiv gewesen. Es gelte, der Welt zu zeigen, wer Herr auf dem Globus ist: mittels kleiner Kriege, militärischer Machtdemonstrationen an den Grenzen der UdSSR und Chinas sowie in der Dritten Welt, psychologische Kriegsführung nicht zu vergessen. Nixon wurde 1969 als 37. Präsident der USA bestallt und kam auf den Autor des Memorandums zurück: Henry Kissinger.
Kissinger, 97 Jahre alt, gilt als Orakel der Realpolitik, als brillanter Historiker und Länderkenner. Sein Leben lang hat er verstanden, sich mit Mächtigen gut zu stellen. Nun hat der Historiker und USA-Experte Bernd Greiner dem Sicherheitsberater von Richard Nixon, dem Außenminister und späteren Berater zahlungskräftiger Kunden, dem Autor vieler Bücher ein bleibendes Denkmal gesetzt: Kissinger ist hochintelligent, ein exzellenter PR-Mann in eigener Sache, eher nicht bewundernswert. Greiners Buch kommt an diesem Donnerstag in die Buchhandlungen. …
Einige Jahre lang hat Bernd Greiner an seinem Buch gearbeitet. Es ist viel mehr als eine exzellente Biografie, es bietet eine Darstellung der Grundzüge und Idiotien amerikanischer Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, sinnfällig gemacht anhand des Gespanns Nixon und Kissinger.
Der Watergate-Skandal hat Nixons Ruf dermaßen erledigt, dass die meisten bei Erwähnung seines Namens an Intrigantentum und Alkohol denken. Kissinger hat sein Teil dazu getan. Wenn es nach ihm geht, war er der Schöpfer der erfolgreichen Verhandlungen mit Russland und China Anfang der 1970er-Jahre. Greiner zeigt, wie es wirklich gewesen ist. Nixon bestimmte die Außenpolitik und konnte dabei Kissinger gut brauchen.
Die beiden waren eines Sinnes: begrenzte Atomkriege sind machbar; Aufrüstung ist nötig; und der Feind – die UdSSR – muss im Unklaren darüber gelassen werden, wie weit man zu gehen beabsichtigt. In Kissinger fand Nixon einen Gehilfen bei der Umsetzung seiner „Madman-Theorie“. Die beschrieb der Präsident so: Im Kreml müsse man denken, „dass dieser Nixon vom Kommunismus besessen ist, dass man ihn nicht bändigen kann, wenn er wütend wird, und dass er obendrein den Finger auf dem Atomknopf hat“.
Nixon war kein netter Arbeitgeber. Seinen Sicherheitsberater mit unflätigen, auch antisemitischen Beschimpfungen zu traktieren, war normal. Kissinger konnte devot sein und sich auf diesen Ton einschwingen.
Nixon bezeichnete seriöse Menschen als Clown, Strolch, Bastard, Hurensohn, Wahnsinniger, Arschloch, Luder, Dummkopf, Schwuchtel, Trampel, Pupser, Zwerg, Schweinepriester, Tussi, Wichser, Gauner, Mistkerl, Hure, Bandit, Kotzbrocken, Trottel, Schwanzlutscher, Ratte. Greiner hat 38 Schimpfwörter zusammengetragen und schreibt lakonisch, seine Liste dürfte „halbwegs vollständig“ sein.
Es war üblich gewesen im Weißen Haus, heimlich Aufzeichnungen der dort geführten Gespräche zu machen. Zu Beginn seiner Amtszeit wollte Nixon das nicht fortführen. Als er aber mitbekam, dass Kissinger hinter seinem Rücken übel über ihn sprach, ließ er eine Abhöranlage installieren. 1973, als der Watergate-Skandal losgebrochen war, machte ein Vertrauter des Präsidenten das öffentlich.
Danach, so Greiner, „wurden die Aufzeichnungen eingestellt, zum Bedauern von Historikern und allen, die sich einen Sinn für unfreiwillige Komik bewahrt hatten“. Diese Aufzeichnungen hätte Nixon besser nicht machen lassen: Sie führten zu seinem Abtritt, denn sie belegten unter anderem, dass er 1972 Einbrecher ins Wahlkampfbüro der Demokratischen Partei im Wohn- und Bürokomplex „Watergate“ geschickt hatte. Per Beschluss des Obersten Gerichtshofs der USA mussten die Aufzeichnungen 1974 herausgegeben werden. Greiner hat sie studiert wie andere die Bibel.
Im Hinblick auf unverträgliches Verhalten stand Kissinger seinem Präsidenten nicht nach. Von 1969 bis 1973 drohte er mindestens 16-mal mit seinem Rücktritt. An haltloses Brüllen mussten seine Mitarbeiter sich gewöhnen; sie lernten, beiseitezutreten, wenn sie mit Gegenständen beworfen wurden. Greiner zeigt, dass Kissinger sich aufgeführt hat wie der Gockel auf dem Mist. Den damaligen Außenminister William Rogers suchte er kaltzustellen. Die Militärs im Pentagon fühlten sich von ihm erniedrigt. Das Gleiche galt für das führende Personal von CIA und FBI.
Vor Watergate hatte Richard Nixon das Heft in der Hand. Er war es, der darauf drang, mit der UdSSR und mit China ein Einvernehmen zu finden. „Tricky Dick“ wollte beide Staaten gegeneinander ausspielen. Das hat recht gut funktioniert. Im Übrigen war die damalige Außenpolitik der USA ziemlich verheerend, ja dümmlich.
Nixon und Kissinger haben den von den vorherigen US-Regierungen geerbten Krieg gegen Nordvietnam sinnlos in die Länge gezogen. Die beiden, so Greiner, „klammerten sich an eine zum Dogma erstarrte Maxime: Solange man nicht wie ein offenkundiger Verlierer dasteht, ist der Krieg gewonnen“.
Greiner weiter: „Wie widerständig ein in Jahrzehnten des Unabhängigkeitskampfes genährter Nationalismus war, wie misstrauisch Hanoi trotz der neuen Waffenbrüderschaft die alte Kolonialmacht China beäugte, wie sehr die Berufsrevolutionäre um Ho Chi Minh auf Rückhalt in der Bevölkerung setzen konnten, wie der Machtapparat in Nordvietnam funktionierte und wer dort überhaupt das Sagen hatte – für derlei Fragen interessierte man sich in Washington schlichtweg nicht.“
Rezension im Deutschlandfunk: „Ein Leben für die Macht“ von Jörg Himmelreich (20.9.2020)
„Greiners Kissinger-Biografie ist hoch aktuell, weil sie zeigt, welch lange zuvor schon etablierten Wesenszüge US-amerikanischer Politik bis heute unter Präsident Trump fortwirken. Man mag sie mit vielen guten Gründen verurteilen. Noch sind die Bundesrepublik und Europa jedoch vom US-amerikanischen Sicherheitsschirm abhängig. Wer daher jenseits berechtigter moralischer Empörung die Unwägbarkeiten und Techniken der Washingtoner Politik von heute erkennen und einschätzen will, der kommt um diese Biografie nicht herum.“
Gewalt. Macht. Hegemonie –Zur Aktualität von Henry Kissinger
Ohne diese Drohung gibt es keine Grundlage für Verhandlungen.«
– Henry Kissinger[1]
Was macht eine Ordnungsmacht, wenn ihr die Ordnung entgleitet? Was bedeutet der Verlust von Macht und Einfluss? Wo ist Amerikas Platz in einer multipolaren Welt? Ist es ratsam, sich dem Wandel entgegenzustellen, ihn gar aufhalten zu wollen? Diese Fragen stellen sich den Vereinigten Staaten seit Jahren. Sie sind also keineswegs neu, sondern drängten bereits Ende der 1960er Jahre mit aller Macht auf die politische Tagesordnung.
Wegen der immensen Belastungen des Vietnamkrieges taumelte der Dollar damals als internationale Leitwährung von einer Krise zur nächsten; die Sowjetunion hatte wegen der Invasion in der CˇSSR zwar politisch einen Rückschlag zu verdauen, befand sich militärisch aber auf dem besten Weg, mit dem Atomwaffenarsenal der USA gleichzuziehen; für die Unabhängigkeitsbewegungen in der Dritten Welt war der „American Way“ mittlerweile ein Entwicklungsangebot unter vielen und beileibe nicht das attraktivste; und obendrein demonstrierte die Bundesregierung in Bonn unter Willy Brandt mit ihrer Ostpolitik, dass Westbindung und eigenständiges Denken kein Widerspruch sein mussten.
Zu Hause ging es ebenfalls drunter und drüber. Wohlfeil war es, sich über die Protestierer aufzuregen, die anlässlich der Nominierung eines Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei unter tätiger Mithilfe der Polizei Chicago in den Ausnahmezustand randalierten. Tatsächlich ging es um viel mehr – um politische Erosionsprozesse auf allen Ebenen, die Elite des Landes eingeschlossen. Vom legendären Nachkriegskonsens blieb angesichts der Wortmeldungen von Parteigranden, Senatoren und „elder statesmen“ nicht mehr viel übrig. Zeitdiagnose im Panikmodus, wohin man auch blickte. Eine Arroganz der Macht attestierten die einen, Torheit und Selbstüberdehnung die anderen. Und allen war Ratlosigkeit gemein. Oder blankes Entsetzen, nachdem Hoffnungsträger wie Robert Kennedy und Martin Luther King von Attentätern niedergestreckt worden waren.
Die Aufgeregtheiten von damals sind heute Geschichte, nicht aber das Thema. Seither wird vor unterschiedlichen Kulissen und mit wechselnder Besetzung über die Rolle der USA als Welt- und Ordnungsmacht gestritten. Was will und kann man erreichen? Mit welchen Mitteln, an wessen Seite und zu welchem Ende? Dass daraus ein immerwährendes Selbstgespräch wurde, liegt an der politischen Beschleunigung des Weltgeschehens, die mit hoher Schlagzahl gewohnte Koordinaten durcheinanderwirbelt und neue Akteure hervorbringt. Multipolarität verträgt sich auf Dauer nicht mit Hegemonie, stabile Bündnisse werden in volatiler Umgebung schnell zum Anachronismus, Dominanz zieht in der Konkurrenz mit kluger Führung den Kürzeren. Was freilich nicht ausschließt, dass Wege in die Zukunft trotz alledem auf den Landkarten der Vergangenheit gesucht werden.
Die Liaison von Macht und Geist
Beim Nachdenken über tragfähige Antworten greifen US-Politiker und Militärs gerne auf ein Modell zurück, das nach der Weltwirtschaftskrise und am Vorabend des Zweiten Weltkrieges seine Bewährungsprobe bestanden hatte – die Liaison von Macht und Geist. Generationen von Intellektuellen verbringen ihr Leben noch immer als Pendler zwischen Universitäten, Denkfabriken und den Vorzimmern der Macht, einige schaffen es als Sekundanten auch in den innersten Kreis. Und manche leiten ihre Wichtigkeit aus der bloßen Behauptung ab, bedeutend zu sein, ehe sie von der Realität eingeholt werden und sich wieder in die lange Beraterschlange einfädeln müssen.
1969 betrat mit Henry Kissinger jener Mann die große Bühne, der zur Inkarnation der Verbindung von Geist und Macht werden sollte. US-Präsident Richard Nixon, der vor seiner Wahl dem Land einen großen Plan versprochen hatte, ohne Genaueres geplant zu haben, machte ihn zu seinem Gehilfen. Kissinger galt als Diener aller Herren, aber auch als Egomane, dessen Zuarbeit Fluch und Segen zugleich sein konnte. Nixon ging das Risiko ein, zumal sein Assistent wichtige Qualitäten für eine Orientierung im Ungewissen mitbrachte. Kissinger hatte sich in Harvard, Washington und New York fast zwanzig Jahre lang in der Grauzone zwischen Wissenschaft und Politik bewegt und das Ideenreservoir zur Pflege amerikanischer Ansprüche aus der Nähe kennengelernt. Mit originellen Einfällen war er nicht hervorgetreten. Wohl aber als Zeitgenosse mit einem ausgeprägten Gespür für wechselnde Stimmungen und der Begabung, Gedanken anderer bündeln und die Synthese als Eigenprodukt ausgeben zu können.
Im Verkauf war er schier unerreicht. Kissinger konnte aus beiden Mundwinkeln zugleich reden und beherrschte die Kunst des raunenden Schreibens sowie der vernebelten Rede. Bei Bedarf schielte er in die eine Richtung und rannte in die andere davon. Diese Flexibilität war in Nixons Augen sogar von Vorteil, jedenfalls im Umgang mit der vermeintlich übelwollenden Presse. Wie auch immer: Kissinger half dem Präsidenten beim Sortieren seiner Vorstellungen. Darunter finden sich drei, die bis heute wie Untote immer wieder durch das Weiße Haus geistern.
Der Urgedanke bis heute: Amerikas Vorherrschaft ist unverzichtbar
Erstens: Amerikas Vorherrschaft ist unverzichtbar. Im moralisch überhöhten Bild der auserwählten Nation ist dieser Anspruch konserviert, eine selbstverordnete Wahrheit im Rang eines Naturrechts. Kissinger verkündete die Begründung. Europäer, so betonte er ausgerechnet 1973 in seiner Rede zum „Jahr Europas“, haben nur regionale Interessen im Blick und können folglich keine globale Verantwortung übernehmen.[2] Eliten der Dritten Welt bestritt er die Fähigkeit zum Denken in weltpolitischen Zusammenhängen ohnehin, in Kissingers Orbit kamen sie bestenfalls als Statthalter des Westens mit klar begrenzten Aufgaben und beschränkter Haftung in Frage – und auch das nur nach Abschluss eines politischen Erziehungsprogramms. Über die Rivalen aus dem sozialistischen Block verlor Kissinger in diesem Zusammenhang nicht viele Worte, stellten sie doch aus seiner Sicht die Legitimität der existierenden Ordnung wie eh und je in Frage. Will sagen: Stabilität ist gleichbedeutend mit amerikanischem Übergewicht, Gleichgewicht der Macht heißt, dass die Vereinigten Staaten ebenso viel oder mehr auf die Waage bringen wie alle anderen Mächte zusammen – jedem einzelnen überlegen, gegen jedes Bündnis gewappnet. Wer aber die Welt für jene ordnet, die im Gebrauch der Macht nicht geübt sind, und vor jenen schützt, die mit Macht Missbrauch betreiben, hat selbstverständlich das Recht zu Alleingängen. Auch so kann und sollte „America First“ gelesen werden.
Zweitens: Eine Führungsmacht braucht den Willen zur Gewalt. Hinter diesen Merksatz setzte Kissinger gleich mehrere Ausrufezeichen, er hatte ihn in seinen Lehr- und Wanderjahren wie kaum etwas anderes verinnerlicht und bei ungezählten Anlässen selbst vorgetragen. Im Kern handelte es sich um eine Polemik gegen die traditionelle Lesart der Abschreckung oder gegen die Annahme vom stummen Wirken der Weltuntergangswaffen. Dergleichen nur zu besitzen, so sein Einwand, ist allenfalls ein Ausweis materieller Stärke. Politische Macht schlägt daraus erst, wer eine Entschlossenheit zum Einsatz dieses Arsenals demonstriert.
Demnach waren gerade im Frieden entwaffnende Auftritte gefragt, um den Krieg zu verhindern – wie zur Zeit der Kuba-Krise, die Kissinger zum Vorbild von Willensstärke und Durchsetzungskraft überhöhte. Dass im Oktober 1962 zum Tanz auf dem Vulkan geladen worden war, ließ er als Einwand nicht gelten. Im Gegenteil: Er münzte die damalige Erfahrung in ein Dogma um. Politische Sicherheit und militärisches Risiko sind zwei Seiten einer Medaille, eine Ordnungsmacht, deren Gewaltbereitschaft in Frage steht, verspielt ihre Glaubwürdigkeit. Auch so wollte Kissinger Realpolitik verstanden wissen. Nämlich als Rückbesinnung auf eine Lektion, die seines Erachtens ohne Not in Vergessenheit geraten war: Diplomaten sichern Frieden nur dann, wenn sie das Handwerk der Nötigung beherrschen. Außenpolitik muss vom Militärischen ausgehend gedacht werden, ansonsten verfehlt sie ihren Zweck.
Drittens: Macht beruht auf Angst. Henry Kissingers publizistischer Durchbruch stand im Zeichen dieser Formel. Sie war der Dreh- und Angelpunkt seines 1957 erschienenen Bestsellers über die Rolle von Nuklearwaffen in der Außenpolitik und markierte den psychologischen Mehrwert erfolgreicher Abschreckung. Niemand soll dem Irrglauben aufsitzen, auf der militärischen Eskalationsleiter mit den USA mithalten zu können, Risiken werden reduziert, sobald die andere Seite mehr Angst vor dem Krieg hat als man selbst. Sicherheit ist demnach kein Gut, das allen gemein ist und von allen gleichermaßen in Anspruch genommen werden kann. Es geht vielmehr um asymmetrische Verteilung. Sicherheit auf der einen Seite steht und fällt mit Unsicherheit auf der anderen Seite.
Nixon – Arroganz der Macht (2) Der Vietnam-Krieg – 10.752 Aufrufe –•12.03.2017 – 20.250 Aufrufe 12.03.2017 –
„Richard Nixon – ein Mann der Extreme. Höhepunkt seiner Karriere: seine Zeit als US-Präsident. Bis ins Frühjahr 1973 galt Richard Nixon als einer der erfolgreichsten US-Politiker des 20. Jahrhunderts. Er hatte den Vietnam-Krieg beendet, war als erster Präsident zu Staatsbesuchen in Peking und Moskau, hatte etwas gegen die Inflation getan. Aber er steht auch für Amerikas berühmtesten Polit-Skandal, die Watergate-Affäre. 1972 war er mit großer Mehrheit wiedergewählt worden.
Dann, im März 1973, begannen die US-Medien über Hinweise zu berichten, nach denen der Präsident verantwortlich für einen Einbruch in den Watergate-Gebäudekomplex gewesen sei, wo die Demokratische Partei ihr Wahlkampfhauptquartier hatte. Schnell verdichteten sich die Gerüchte zur skandalösen Gewissheit. Nach einer ganzen Reihe weiterer Enthüllungen über Fälle eklatanten Amtsmissbrauchs trat Richard Nixon am 9. August 1974 zurück – als erster und bislang einziger US-Präsident.
Ein Mann der Widersprüche Die Dokumentation zeichnet das Psychogramm eines hochbegabten Politikers mit zwiespältigem Charakter – eine politische Karriere mit viel Licht und noch mehr Schatten. Im Weißen Haus herrschte damals eine Atmosphäre des Misstrauens, die bei Nixon kriminelle Energien freisetzte. Nixon, Sohn einer christlichen Mutter mit moralischen Ansprüchen, war ein Mann der Extreme und Widersprüche. Er sprach von Recht und Ordnung und hatte kriminelle Kontakte. Er predigte Offenheit und Ehrlichkeit und log im nächsten Moment. Er versprach Frieden und förderte den Krieg. Der Film enthüllt seine emotionalen und mentalen Probleme. Seine Stimmungsschwankungen – und das bei dem Mann, der den Finger am atomaren Zündknopf hatte.“


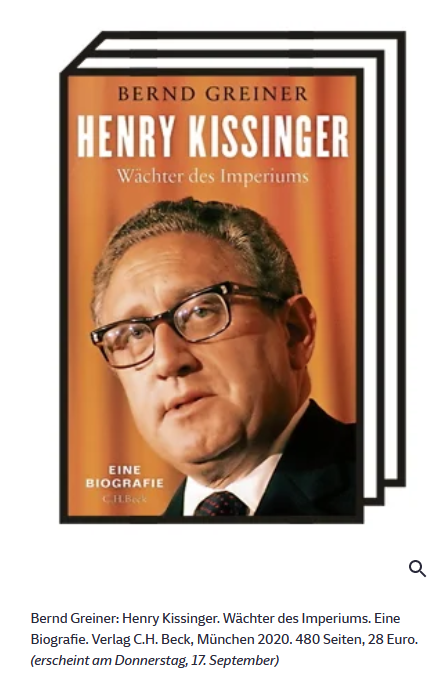

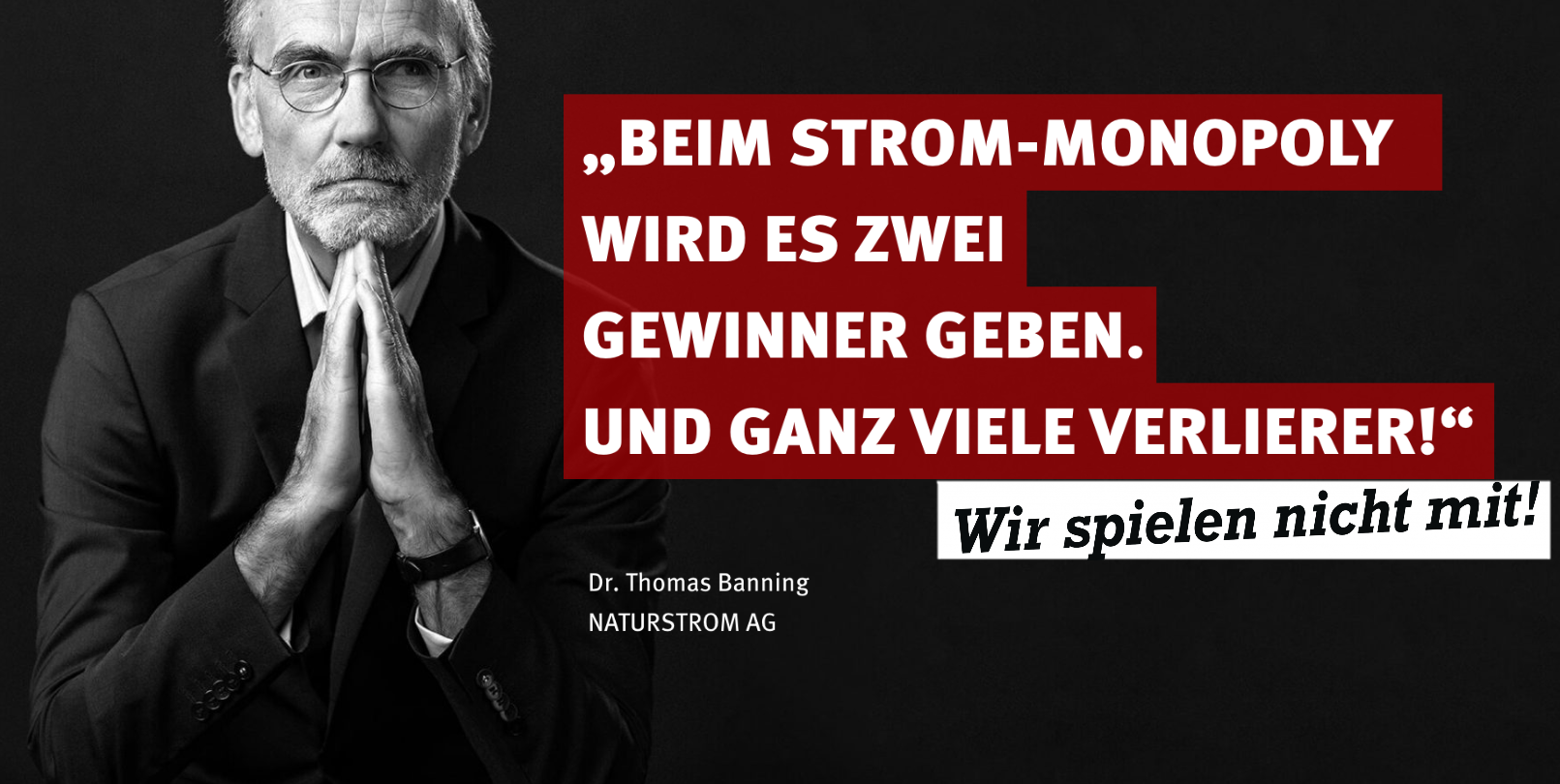
 Die Mitglieder der Initiative
Die Mitglieder der Initiative