taz lab 2022: Klima, Klasse, Krieg mit Ulrike Herrmann und Ulrike Winkelmann –27.487 Aufrufe 08.07.2022 –taz
„Wer soll das bezahlen? … Wer hat so viel Geld?“
Der Kapitalismus produziert Krisen – immer und immer wieder. Das ist zwar linke Folklore, wird dadurch aber nicht weniger wahr: Klimakrise, Pandemie, Inflation, Krieg. Eine Wirtschaft, die stetig und ungebremst wächst, ist hungrig nach immer mehr Ressourcen, nach immer mehr billiger Energie.
Ist die Klimakrise also ein kapitalistischer Nebenwiderspruch? Sind CO²-Bepreisung, der Ausbau von Energiespeichern und eine Elektrifizierung schon Schritte in Richtung grünes Wachstum? Können wir die Wirtschaft überhaupt weiter wachsen lassen, ohne die Welt zu ruinieren? Referierende: Ulrike Herrmann taz-Wirtschaftskorrespondentin Moderation: Ulrike Winkelmann Chefredakteurin der taz
Am 30. April fand das taz lab 2022 statt, und wir konnten auf zahlreichen digitalen Veranstaltungen live mit Robert Habeck, Luisa Neubauer, Swetlana Gannuschkina, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Deniz Yücel, Sarah-Lee Heinrich, Karl Lauterbach, Lars Klingbeil, Jagoda Marinić, Harald Welzer und vielen weiteren starken Stimmen der Gegenwart diskutieren.
Unter der Überschrift „Klima, Klasse und Krieg“ wurde in über 80 Veranstaltungen heiß und konzentriert diskutiert. Klimaschutz ja, aber wer soll das bezahlen?
- Wie lassen sich Maßnahmen gegen aktuelle und zukünftige Folgen des Klimawandels mit der Frage nach gesellschaftlicher Gerechtigkeit und Solidarität vereinbaren?
- Und was macht der Ukraine-Krieg mit unserer Zukunft?
- Gibt es noch Grund zu Optimismus?
Sämtliche Diskussionen wurden mitgeschnitten, so dass Sie nach wie vor die Möglichkeit haben, sich das ein oder andere oder gleich das ganze Programm gemütlich zu Hause auf dem Sofa anzuschauen. Sie können sich aus mehr als 80 Stunden Material von über 200 Referent:innen Ihre eigene Mediathek zusammen stellen.
Alle Infos und Tickets hier: https://taz.de/taz-lab-2022-in-der-Me…


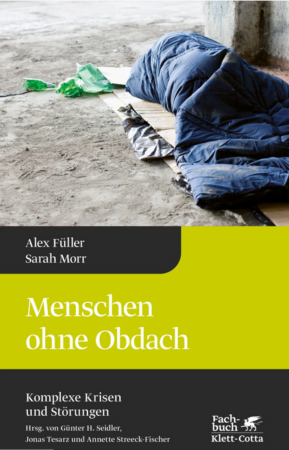 Wohnungslos und ausgegrenzt – wie kann geholfen werden?
Wohnungslos und ausgegrenzt – wie kann geholfen werden?
 Alex Füller. Sarah Morr. Menschen ohne Obdach. Reihe: Komplexe Krisen und Störungen 5 (mit einem Vorwort von Christoph Butterwegge). 1. Aufl. 2021, 240 Seiten
Alex Füller. Sarah Morr. Menschen ohne Obdach. Reihe: Komplexe Krisen und Störungen 5 (mit einem Vorwort von Christoph Butterwegge). 1. Aufl. 2021, 240 Seiten