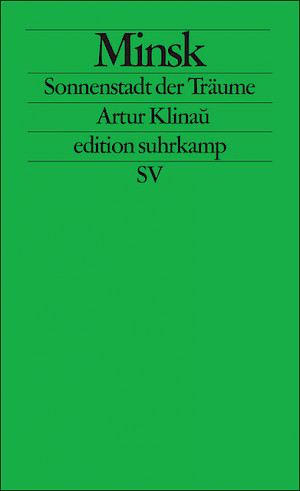13.7.2020 – 22:20, Tomasz Kurianowicz
Streit um Debattenkultur: Haltet doch mal eine andere Meinung aus!
Songs, Filme, Meinungen werden immer häufiger aus dem Diskurs verbannt. Das ist oft richtig. Doch die „Cancel Culture“ hat eine gefährliche Kehrseite.
Berlin Um 1800 wäre es im Hause des Dichters Heinrich von Kleist fast zu einem Akt der „Cancel Culture“ gekommen. So nennt sich der jüngste Trend, unliebsame Meinungen oder künstlerische sowie publizistische Inhalte, die nicht den Regeln der politischen Korrektheit entsprechen, zu zensieren, abzubestellen, zu löschen, aus dem Diskurs zu verbannen, sie zu „canceln“. Kleist wäre diesem Impuls fast erlegen, nachdem er Immanuel Kants bahnbrechende Studie „Die Kritik der Urteilskraft“ gelesen hatte.
Die Reaktion des Dichters ist historisch nicht verbrieft. Man muss sie als Anekdote verstehen, und doch hätte sie so passiert sein können. Heinrich von Kleist soll nämlich der Legende nach von Kants Standardwerk so schockiert gewesen sein, dass er regelrecht in eine Kant-Krise verfiel. Die Studie erschien in einer Zeit, in der immer noch die christliche Theologie die Deutungshoheit hatte. Damit wollte Immanuel Kant aufräumen. Er hat den Verstandesraum neu vermessen und gezeigt, was der Mensch wissen (wenig) und was er nur glauben kann (viel). Der Text gilt als Verabschiedung des christlichen Allwissenheitsanspruchs. So wie für Kleist war die Studie für die westliche Zivilisation um 1800 ein Epochenbruch. Der Legende nach soll Kleist die „Kritik der Urteilskraft“ nach der Lektüre wütend zugeklappt und gegen die Wand geschmissen haben.
Die Flexibilität der Ideen steht auf dem Spiel
Kleist hätte die Studie am liebsten ignoriert, sie aus seinem Bewusstsein verbannt, sie „gecancelt“. Aber das ging nicht. Der Text bohrte sich in Kleists Bewusstsein. Und dann passierte etwas Magisches: Nach längerer Reifezeit gab der Dichter seiner Schockerfahrung ein künstlerisches Ventil. Sein ganzes Werk sollte von nun an um die Frage kreisen, was der Mensch wissen und wie er noch glauben kann, ohne an seinen Verstandesgrenzen zu verzweifeln. Ein Beweis dieser Auseinandersetzung ist ein Brief, den Kleist 1801 an seine Freundin Wilhelmine von Zenge verfasste: „Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün – und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört. So ist es mit dem Verstande. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint.“
Wäre Kleist heute am Leben, hätte er den Schock nicht in Prosa- und Dramentexten verarbeitet, sondern in blanken Wutkaskaden. Im schlimmsten Fall hätte er einen verkürzenden, zugespitzten Tweet über den Inhalt von Kants Studie gelesen („Gott ist tot“) und eine erboste Nachricht in die Tastatur getippt („Hab noch nie so einen Mist gelesen!“). Und genau diese Reaktionsspiralen sind heute in Diskussionen oft zu beobachten. Verkürzte Aufmerksamkeitsspannen fördern die Ignoranz gegenüber fremden, sperrigen, unliebsamen Gedanken, weil man sie impulsiv für falsch, böse, politisch inkorrekt, dem eigenen ideologischen Projekt für unzuträglich hält. Statt sich an fremden Ideen zu reiben, sie zu verstehen und zu durchdringen, sich an ihnen zu messen, sie mit guten Argumenten zum Stillstand zu bringen, reagieren wir reflexhaft mit Aggressivität und Intoleranz. Sowohl auf der linken wie auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Beide Seiten wollen sich nicht mehr austauschen, sondern krallen sich an der eigenen Meinung wie an orthodoxen Glaubenssätzen fest. Die Flexibilität der Ideen, die jede freie Gesellschaft im Wesenskern ausmacht, steht auf dem Spiel.
Es kommt zu Shit-Stürmen
Diese Tendenz macht auch zeitgenössischen Denkern zu schaffen. Vergangene Woche haben 153 Intellektuelle aus aller Welt einen offenen Brief verfasst, in dem sie kritisieren, dass die moralischen Standards der politischen Korrektheit das Recht auf freie Meinungsäußerung bedrohen. In dem Schreiben, das unter anderem im Haper’s Magazine in den USA erschienen ist, heißt es: „Heftige Proteste gegen Rassismus und für soziale Gerechtigkeit haben zu Forderungen nach einer Polizeireform und nach mehr gesellschaftlicher Gleichberechtigung geführt – an Hochschulen, im Journalismus, in den Künsten. Diese notwendige und überfällige Abrechnung stärkt aber auch moralische Einstellungen und politische Bekenntnisse, die jede offene Debatte und das Aushalten von Differenzen zugunsten einer ideologischen Konformität schwächen.“
Die Sorge ist, dass nuancierte Beobachter, trotz ihrer Solidarität für Schwache und Diskriminierte, sich der Sabotage und Verteidigung weißer Privilegien verdächtig machen, wenn sie ein komplexes Bild der Realität zeichnen, das in die neuen moralischen Standards der Identitäts- und Gerechtigkeitspolitik nicht passt. Da komplexe Gedanken den Aufmerksamkeitsspannen in den sozialen Medien zuwiderlaufen, entstehen Empörungswellen ohne Quellenbezug, die zu ungerechtfertigten Shit-Stürmen führen. Auch über den offenen Brief der 153 Intellektuellen wird jetzt hitzig debattiert.
Sind Goethe und Schiller toxisch-männlich?
Nuancierte Betrachter überlegen sich also im Vorfeld, ob sie sich zu besonders aufgeladenen Themen wie Polizeigewalt, Sexismus, Minderheitenrechte publizistisch äußern wollen, wenn eine aggressive Netzgemeinde förmlich darauf wartet, moralische Grauzonen aufzuspüren und unliebsame Denker abzustrafen – vielleicht weil sie sich wegen ihrer Identität („alter weißer Mann“) gar nicht hätten äußern dürfen. Auf der anderen Seite warten rechte Trolle darauf, Gerechtigkeitskämpfer mit Hassbotschaften einzuschüchtern und mundtot zu machen. Beide Strategien mögen ein Weg sein, sich eine hörbare Stimme zu verschaffen. Nur muss sich jeder bewusst sein, dass Zensur-Mechanismen eine Lagerbildung befördern, die jede Kompromiss- und Konsenssuche unmöglich machen.
Der Begriff der „Cancel Culture“ führt moderne westliche Gesellschaften in einen Widerspruch. Das muss auch die politische Linke erkennen. Niemand würde behaupten, dass es moralisch zweifelhaft wäre, Hitler-Statuen zu stürzen, Hakenkreuze zu verbieten oder Hassrede und Verleumdung unter Strafe zu stellen. Doch wo ist die Grenze? Gehören Goethe und Schiller noch gelesen? Oder sind die beiden Schriftsteller Teil einer toxischen Männlichkeit, die in den historischen Giftschrank gehört? Die Meinungsfreiheit braucht zweifellos Grenzen. Manchmal lassen sich diese Grenzen leicht ziehen. In anderen Fällen müssen sie Gegenstand einer intensiven Diskussion sein, die sich jede freie Gesellschaft im ständigen Ringen und Abwägen selbst auferlegen muss.
Den Kanon ausgewogen lesen und kritisieren
Im Kern hat die „Cancel Culture“ ihre volle Berechtigung, vor allem wenn sie Inhalte zensiert, die eindeutig die Menschenwürde verletzen oder rassistische und sexistische Rede propagieren. Darüber muss man als Demokrat nicht lange streiten. Ähnlich notwendig ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kanon. Viel zu lange hat die westliche Elite die moralischen Verfehlungen ihrer Vorfahren toleriert und kulturell vererbte Klischees blind verteidigt. Viel zu lange sind die Auswirkungen verbaler Gewalt im öffentlichen Raum ignoriert worden. Viel zu lange sind Intellektuelle und westliche Philosophen, Künstler, Entertainer, Politiker von den Institutionen verklärt und glorifiziert worden.
In den USA hat jüngst ein Nachfahre von Thomas Jefferson gefordert, die Statue seines Ahnen zu Fall zu bringen, weil dieser zwar „die Gleichheit aller Menschen“ in seinen Schriften verteidigte, aber privat ein Sklavenhalter war. Es tut gut, dass mit kanonischen Werken, historischen Figuren und den überhöhten Idealismen der Geschichte so selbstkritisch abgerechnet wird. Auch die jüngst in Deutschland geführte Diskussion um rassistische Tendenzen bei Immanuel Kant, die zweifellos existieren, ist notwendig und richtig. Man kann das große, philosophische Werk Kants würdigen, ohne gleichsam seine anthropologischen Ansichten zu verteidigen. Auch kann man Kleists Sprache feiern, ohne sein Frauenbild anzunehmen. All diese Balanceakte sind möglich, wenn wir uns Zeit nehmen, den Kanon ausgewogen zu lesen und ihn dort zu kritisieren, wo er moralische Standards verletzt.
Das biblische Rechtsverständnis
Kritische Auseinandersetzung darf aber nicht dazu führen, dass sich Andersdenkende im öffentlichen Diskursraum bedroht fühlen, nur weil sie zu anderen Urteilen kommen als die moralische Masse. Das eine ist, jemanden darauf hinzuweisen, dass er sich – vielleicht unwissentlich – einer rassistischen Tradition bedient. Das andere ist, eine unliebsame Stimme mit Schikanen und Zensur-Forderungen zum Schweigen zu bringen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel.
Wahr nämlich ist auch, dass jede „Cancel Culture“ eine gefährliche Kehrseite hat. Der Rassismus-Vorwurf darf nicht die Ausrede sein, die Mühen hermeneutischer Arbeit zu vermeiden. Die „Cancel Culture“ kann schlimme Schäden anrichten, wenn sie ihre utopischen Energien – wie zu Zeiten der französischen Revolution – in dystopische Nebenkämpfe verwandelt und im Eifer des Gefechts hohe Kollateralschäden erzeugt. Getreu dem Motto: Wenn Minderheiten jahrhundertelang diskriminiert wurden, haben sie jetzt das moralische Recht, mit gleicher Härte zurückzuschlagen. (Rein formal ist das übrigens eine legitime Forderung, über die sich diskutieren ließe. Doch dann würde das biblische Rechtsverständnis zurückkehren.)
Ein Kulturkampf zwischen Jung und Alt
Die taz-Satire von Hengameh Yaghoobifarah über die Polizei und ihre Beziehung zum Müll ist ein treffendes Beispiel für die verhärteten Fronten. Keine Seite des politischen Spektrums hat sich hier vorbildlich verhalten. Innenminister Horst Seehofer wollte Strafanzeige stellen und die Autorin schlichtweg „canceln“. Die freien Mitarbeiter der taz wiederum, die sich hinter Yaghoobifarah stellten, wollten ihre Chefredakteurin „canceln“, weil sie sich nicht solidarisch zeigte und in einem Leitartikel den Satire-Text angriff. Auch hier schaukelten sich die Empörungswellen gegenseitig hoch. Gezeigt hat der Konflikt vor allem, dass eine wachsende Zahl an jungen taz-Autor*Innen eine andere Debattenkultur will als ihre Vorgänger. Die jungen Journalisten sehen sich als Verfechter eines Kulturkampfs, der die „Cancel Culture“ und radikale Formen der Identitätspolitik im Gerechtigkeitsstreben unterstützt, während die älteren Journalisten einen Dialog nach liberalen Standards wollen (des „white privilege“?), in dem auch die Rechte von Polizisten ihren Platz haben.
Interessanterweise deutet sich der Konflikt zwischen Jung und Alt auch in anderen Redaktionen an. Eine Mitarbeiterin der Meinungsseite der New York Times, Bari Weiss, ist ebenfalls eine Unterzeichnerin des offenen Briefes der 153 Intellektuellen, die ihre Meinungsfreiheit bedroht sehen. Bei Twitter hat sie eine Erklärung abgegeben, warum sie unterzeichnet hat. Sie schreibt, dass in der New York Times ein Bürgerkrieg herrsche, der zwischen den Jungen und den Alten ausgetragen wird. Die Alten hätten die Jungen angestellt in der Annahme, sie würden für liberale Werte stehen. Doch das sei nicht der Fall. Die Jungen hätten eine andere Weltsicht, die man „Safetyism“ nennen könnte. Sie fordern das Recht, sich emotional sicher zu fühlen – und dieses Gefühl sei wichtiger als „freie Rede“. Mit anderen Worten: Konservativen wie Donald Trump und Steve Bannon, so die Jungen, dürfte man publizistisch kein Gehör verschaffen, da die Gefahr droht, dass ihre Rede die Gefühle von Minderheiten verletzt. Ist so eine Art von Sprechverbot legitim? Bari Weiss schreibt: „Vielleicht ist die Antwort ‚ja‘. Falls die Antwort ‚ja‘ lautet, heißt das aber auch, dass die Meinung einer Hälfte der Amerikaner als inakzeptabel gilt.“
Eine ähnliche Debatte könnte man auch in Deutschland führen. Wer darf sprechen? Wer darf schreiben? Wer darf sich äußern? Muss man rechte Positionen ignorieren? Sie verschwinden dadurch ja nicht. Auch in Deutschland wachsen die Gräben, verhärten sich die Fronten. Was in der Diplomatie mit anderen Staaten gilt, muss also auch innerhalb einer Gesellschaft gelten: Der Dialog darf nicht abbrechen. Setzen wir eine andere Brille auf. Probieren wir – wie Kleist – die grünen Gläser, um die Welt mit anderen Augen zu sehen – sei es sogar mit den Augen des Feindes. Danach können wir sie wieder absetzen, debattieren, sprechen, streiten und unseren Standpunkt verteidigen. Nur so hat unsere Meinung eine Chance, auch vom Gegner gehört zu werden. Und genau darauf kommt es ja an.
Debatte: Ach, ihr Linken! Gebt doch endlich Gedankenfreiheit
Mit kühnen Thesen riskiert man als Denker seinen Job. Cancel Culture gibt es wirklich. Die Ersten verstecken sich im Intellectual Dark Web. Ein Debattenbeitrag. 23.8.2020 –
Wer die Cancel-Culture nicht ernst nimmt, schaue in die USA: Dort werden nicht nur falsche Meinungen, sondern auch Falschmeinende bekämpft. Eine Warnung. Von Yascha Mounk 12. August 2020. ZEIT online.




 Bernie Sanders verlor die Vorwahlen an Hillary Clinton, die zur US-Präsidentschaftskandidatin für die Demokratische Partei gewählt wurde. Doch Bernie Sanders Verlust war legendär und was Bernie Sanders Ende schien, war hingegen der Anfang einer politischen Bewegung.
Bernie Sanders verlor die Vorwahlen an Hillary Clinton, die zur US-Präsidentschaftskandidatin für die Demokratische Partei gewählt wurde. Doch Bernie Sanders Verlust war legendär und was Bernie Sanders Ende schien, war hingegen der Anfang einer politischen Bewegung.