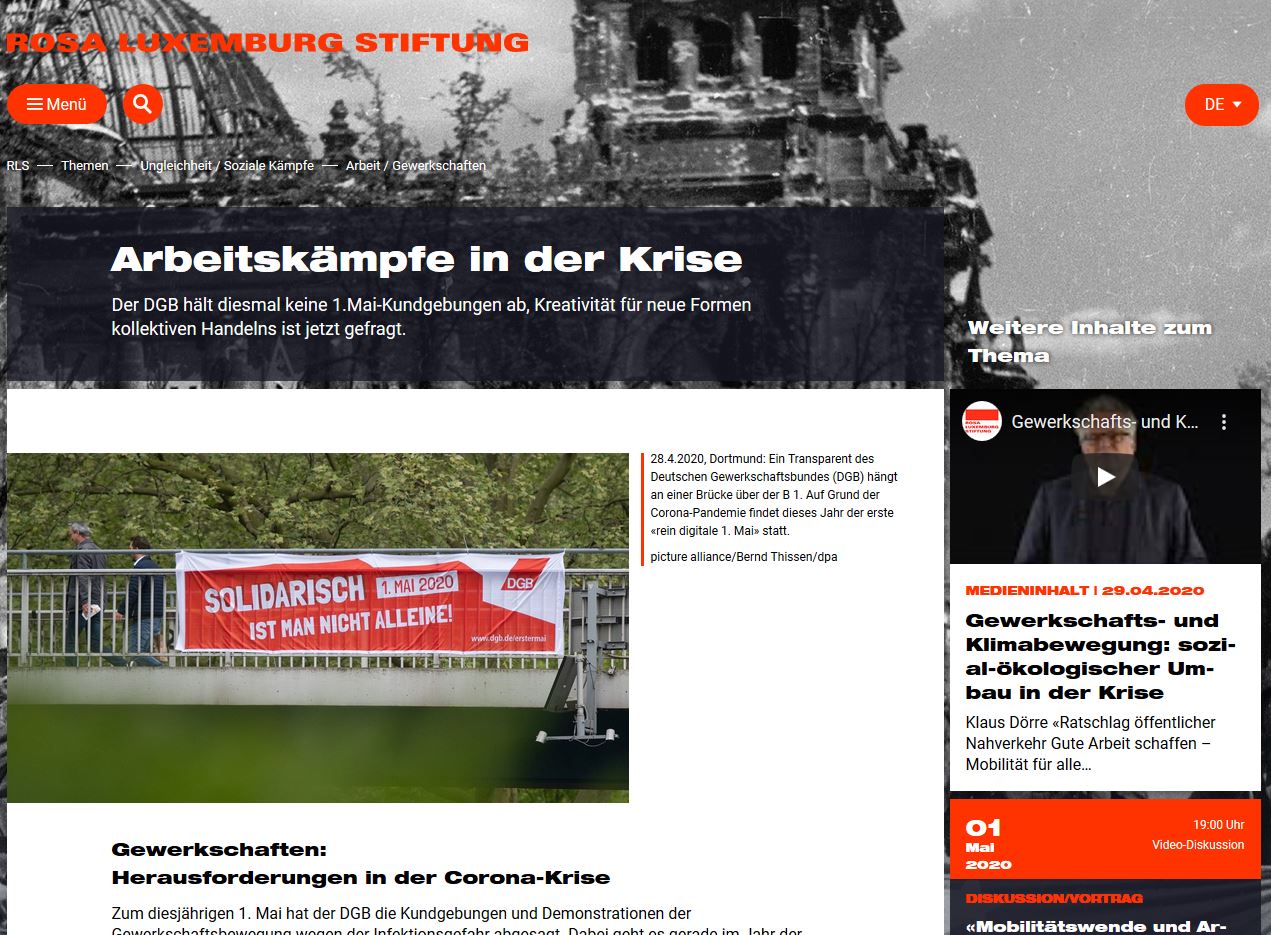Quelle: Blätter für deutsche und internationale Politik, Ausgabe Mai 2020
Von Steffen Vogel
Der Corona-Crash: Die zweite Eurokrise?
Es waren starke Worte, die Ursula von der Leyen Ende März im aus Infektionsgründen fast leeren Plenarsaal des Europaparlamentes fand: „Die Geschichte schaut auf uns. Lassen Sie uns gemeinsam das Richtige tun – mit einem großen Herzen, nicht mit 27 kleinen.“[1] Die Kommissionspräsidentin reagierte damit auf einen beschämenden Mangel: In den ersten Tagen nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa, dem größten Schock seit dem Zweiten Weltkrieg, war von Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union nichts zu spüren.
Die Regierungschefs behandelten die Krise zunächst als eine rein nationale, ganz so, als ob Viren in unseren vernetzten Gesellschaften an den eilig abgeriegelten Grenzen halt machen würden. Selbst als Italiens Botschafter bei der EU Ende März um Schutzmasken für sein schwer getroffenes Land bat, kassierte er nur Absagen; Deutschland beispielsweise hatte zwischenzeitlich einen Exportstopp verhängt. Schließlich besannen sich die anderen Europäer zwar eines Besseren, aber da hatte China – das Italien in seine Neue Seidenstraße einbinden möchte – schon öffentlichkeitswirksam geliefert. Europa versagte in jenen Tagen nicht nur menschlich und politisch, sondern auch geostrategisch.
Seither hat es viele Solidaritätsappelle aus allen Ecken der EU gegeben. Doch so sehr sich Europas Regierungen darüber einig sind, dass diese Krise für die EU eine „Bewährungsprobe“ (Angela Merkel) darstellt, so umstritten bleibt doch, wie eine europäische Antwort aussehen soll. Besonders in der Eurozone prallen auch nach mehreren Videokonferenzen die Gegensätze immer noch hart aufeinander, gipfelnd im Streit um Coronabonds. So fehlt es bislang an einem starken Signal der Einheit an die Bürger des Kontinents, aber auch an die nervösen Finanzmärkte. Das aber ist hochgefährlich, könnte es doch die wütende Abwendung vieler Europäer von der EU zur Folge haben. Aus der Corona- droht damit eine zweite Eurokrise zu werden, die noch schwerer zu bewältigen wäre als die erste – wenn überhaupt.
Schon die erste Eurokrise, die vor zehn Jahren begann, war ganz wesentlich eine Folge politischen Scheiterns: Das Fehlen einer schnellen, solidarischen Antwort auf die finanziellen Probleme Griechenlands führte 2010 zu Unruhe auf den Finanzmärkten, die auch andere südeuropäische Staaten mit sich riss und schließlich die Eurozone als ganze bedrohte – und mit ihr die EU.
Im Fokus standen schon damals die rezessionsgeplagten Mitglieder Italien und Spanien, die als dritt- und viertgrößte Volkswirtschaft des Euroraums zu groß waren, um notfalls mit europäischen Krediten vor einem Staatsbankrott geschützt zu werden. Erst als Mario Draghi, seinerzeit Chef der Europäischen Zentralbank, im Herbst 2012 ankündigte, zur Not unbegrenzt Staatsanleihen kriselnder Eurostaaten anzukaufen, beruhigte sich die Lage – zumindest ökonomisch, nicht aber politisch. Denn die maßgeblich von Deutschland forcierten Kreditauflagen – radikale Austeritätspolitik mit ihren dramatischen gesellschaftlichen Folgen – hatten einen Keil zwischen die Euroländer getrieben, was 2015 zum letztlich vergeblichen Aufbegehren Griechenlands führte.[2] Die fatale politische Spaltung jener Jahre wirkt bis heute nach und prägt ganz entscheidend die unterschiedlichen Reaktionen auf die Coronakrise.
Dabei rächt sich, dass die Eurozone in den Jahren seit 2015 keine Institutionen geschaffen hat, um eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik zu betreiben. Ein europäischer Finanzminister etwa – von Frankreich gefordert, von Deutschland blockiert – hätte eine gesamteuropäische Lösung präsentieren können und damit eine wirtschaftspolitische Debatte angestoßen, statt wie jetzt einen Streit zwischen Nationen. Dabei tritt mit aller Heftigkeit ein ungelöster Grundsatzkonflikt zu Tage: Nach wie vor begreifen etwa die Regierungen Deutschlands und der Niederlande ökonomische Krisen nicht primär als Ausdruck struktureller Defizite in Europa, sondern als Ergebnis eines politisch-moralischen Versagens der betroffenen Länder. Südlicher Schlendrian habe demnach zur Überschuldung Griechenlands oder Italiens geführt. Daher wollen sie selbst jetzt in einer akuten Notlage nicht für ihre Nachbarn haften. Denn wer das damit verbundene finanzielle Risiko eingehe, so ihr traditionelles Kernargument, müsse auch Kontrollbefugnisse haben. Besonders unverblümt zeigte sich dies jüngst in den Worten des niederländischen Finanzministers Wopke Hoekstra. Der Christdemokrat hatte allen Ernstes eine Untersuchung darüber gefordert, warum manche südeuropäischen Staaten so schlecht auf die Pandemie vorbereitet gewesen seien.
Wen wundert es da, dass viele Südeuropäer die derzeitige Debatte um die Grenzen der europäischen Solidarität angesichts des massenhaften Sterbens in ihren Ländern schlicht als hartherzig und kleinlich empfinden. Deutlich wurde dies im empörten Ausbruch des spanischen Premierministers Pedro Sánchez in einer Videokonferenz der EU-Regierungschefs gegenüber Angela Merkel: „Begreifen Sie denn nicht, welchen Notstand wir hier erleben?“[3] Sánchez und andere verlangen ein starkes Zeichen, dass die Staaten der Eurozone nicht nur in einem Boot sitzen, sondern sich ihren Sitznachbarn auch verpflichtet fühlen.
Geteilte Lasten
Ein solches Signal wären – neben den schon vereinbarten europäischen Kreditlinien für Unternehmen und dem Kurzarbeitergeld – vor allem jene Coronabonds, gegen die sich Berlin und Den Haag sperren. Von neun Eurostaaten werden sie mit enormer Vehemenz gefordert – darunter neben den Südeuropäern auch westeuropäische Länder wie Belgien, Luxemburg und vor allem Frankreich.
Die Eurostaaten würden mit diesen Bonds gemeinsame Anleihen auflegen und dafür dank der deutschen Kreditwürdigkeit nur niedrige Zinsen zahlen. Bislang müssen hochverschuldete Eurostaaten wie Italien auf den Finanzmärkten im Vergleich zu Deutschland Aufschläge in Kauf nehmen. Diese sogenannten Spreads steigen derzeit wieder, da Anleger angesichts der enormen Lasten, die auf Italien zukommen, zunehmend nervös werden. Damit drohen Rom deutlich höhere Kosten für den Wiederaufbau. Die „Financial Times“ bringt diese Gefahr so auf den Punkt: „Solange die Eurostaaten nicht das Risiko teilen, werden sich Investoren gezwungen sehen, sich auf das finanzielle Risiko jedes einzelnen Landes im Kampf gegen die Pandemie zu fokussieren.“[4] Im schlimmsten Fall steigen die Aufschläge derart, dass Länder wie Italien nicht genügend Mittel aufnehmen können, um die Krise zu bewältigen. Sie blieben dann für Jahre in einer Dauerkrise gefangen.
Aus diesem Grund taugt auch die Lösung nicht, die Berlin und Den Haag ins Feld führen: Kredite aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Der ESM wurde in der Eurokrise geschaffen, daher rührt auf den Märkten sein Ruf als Notfallinstrument. Wer sich jetzt an ihn wendet, „wird automatisch als offizieller Pleitekandidat gebrandmarkt“, so die Finanzökonomin Doris Neuberger.[5] Zudem reichen die Mittel des ESM nicht aus, um die enormen Kosten des Wiederaufbaus zu stemmen. Und Kredite erhalten die besonders betroffenen Staaten derzeit schon von der EZB. Was sie jetzt aber brauchen, sind „Finanztransfers“, wie selbst der arbeitgebernahe Ökonom Michael Hüther treffend feststellt.[6] Das würde es den Regierungen ermöglichen, die nötigen milliardenschweren Investitionen in ihre pandemiegeschädigte Wirtschaft zu tätigen, ohne ihre Schulden noch weiter zu vergrößern und sich dadurch langfristig weiter zu schwächen. Europäische Bonds wären dafür die wirkungsvollste Lösung: Die Eurostaaten nähmen dann gemeinsam zu niedrigen Kosten Kredite auf und würden sie auf eine Weise untereinander verteilen, die dem erhöhten Bedarf von Ländern wie Italien und Spanien entspricht. Diese Lastenteilung käme letztlich allen zugute, weil sie die Eurozone stabilisieren würde.
Das gilt nicht nur in ökonomischer, sondern auch in politischer Hinsicht. Besonders deutlich zeigt sich das in Italien. Das Gründungsmitglied der EU war das erste Epizentrum der Pandemie außerhalb Asiens und lebt seither mit täglichen Schreckensmeldungen über Triage in Krankenhäusern, vom Virus dahingeraffte Ärztinnen und Pfleger sowie einsame Begräbnisse.
Es ist aber auch ökonomisch und politisch besonders verwundbar: Italien erlebt seit 2008, dem Beginn der Weltwirtschaftskrise, schon seine dritte Rezession und ist mit 135 Prozent seiner Wirtschaftsleistung hochverschuldet. Zudem hat das Land jahrelang auf Brüsseler Druck gespart, gerade auch im Gesundheitssektor. Dort wurden zwischen 2009 und 2017 mehr als 46 000 Stellen gestrichen, so dass nur noch 5,8 Krankenpfleger auf tausend Einwohner kommen, in Deutschland sind es immerhin 12,9. Auch die Krankenhäuser sind schlechter ausgestattet als bei den nördlichen Nachbarn: Zu Beginn der Pandemie standen in Deutschland 33,9 Intensivbetten pro 100 000 Einwohner zur Verfügung, in Italien nur 8,6.[7] Diese Kürzungen werden in Italien oft als deutsches Diktat begriffen. Jetzt lösen sie bei vielen Wut aus, nach dem Motto: Erst zwingt uns Deutschland zu Austerität, dann will es uns keine Atemschutzmasken schicken und schließlich verweigert es uns auch noch Coronabonds.
Die rechtsradikale Lega um ihren Chef Matteo Salvini setzt bereits alles daran, diese Wut weiter zu schüren und auszubeuten. War Salvini zu Beginn der Pandemie noch abgemeldet, weil seine Kritik am souverän agierenden Premierminister Giuseppe Conte schlecht ankam, so nutzt er jetzt die harte Haltung in Berlin und Den Haag für spaltende Polemik. ESM-Kredite geißelt er als „Ausverkauf unserer Zukunft“, auch deswegen gelten sie im Land als „toxisch“.[8] Das fällt ihm umso leichter, als die demütigende Behandlung Griechenlands, das in der Eurokrise ESM-Kredite beantragen musste, durch die europäischen Gläubiger in Italien – und nicht nur dort – noch derart präsent ist, dass Salvini erfolgreich an die Angst vor ökonomischer Fremdherrschaft anknüpfen kann.
Conte drängt also auch aus politischen Gründen auf Coronabonds. Denn die europäische Zukunft seines Landes ist alles andere als garantiert. Seit der Eurokrise wächst in Italien die Skepsis an der EU – und diese haben Berlin und Den Haag nun nochmals erheblich gesteigert: Mittlerweile sind 49 Prozent der Italiener für einen EU-Austritt ihres Landes, im vergangenen November waren es bloß 29 Prozent. Ein italienischer Exit aber wäre, ganz im Gegensatz zum letztlich stabilisierend wirkenden Brexit, für Euro und EU kaum verkraftbar. Salvini, dessen Lega nach wie vor die Umfragen anführt, hat wiederholt mit einem Austrittsreferendum kokettiert. Sollte er die nächste Wahl gewinnen, könnte er diese Ankündigung wahrmachen.
Eine tödliche Gefahr
Es ist daher nicht übertrieben, wenn der inzwischen 94jährige große Europäer Jacques Delors warnt, „der Mangel an europäischer Solidarität“ bilde „eine tödliche Gefahr für die Europäische Union“.[9] Zwar mag die zitierte Umfrage eine Momentaufnahme sein, aber solche negativen Dynamiken können sich verstetigen, besonders im Fall einer anhaltenden Rezession mit hoher Arbeitslosigkeit und verbreiteten Abstiegsängsten.
Umso fataler ist die harte Haltung von Merkel und ihrem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte. Merkel fürchtet zwar nicht ohne Grund den Widerstand aus konservativen Kreisen gegen Coronabonds – und deren mögliche Hinwendung zur AfD –, doch selbst im haftungs- und austeritätsfixierten Deutschland wird die Debatte inzwischen offener geführt als noch vor zehn Jahren: Auch prominente CDU-Politiker wie Norbert Lammert und Elmar Brok plädieren für Coronabonds – die Kanzlerin wäre also auch im eigenen Lager nicht isoliert. Ruttes Regierung wiederum versucht, die vakante britische – euroskeptische und marktradikale – Position auszufüllen: Sie opponiert auch deshalb gegen Coronabonds, weil sie den Einstieg in eine europäische Finanzpolitik verhindern will. Genau dies ist aber überfällig: Die EU ist längst nicht mehr nur ein Bündnis einzelner Staaten, die allein für ihre wirtschaftliche Lage verantwortlich sind. Vielmehr hat sie gemeinsame Institutionen ausgeprägt, von denen insbesondere die gemeinsame Währung auch eine gemeinsame Politik erfordert, inklusive gemeinsamer Haftung. In diesem Sinne betrachtet etwa der OECD-Generalsekretär Coronabonds als nötigen weiteren Schritt der europäischen Integration.
Doch selbst wenn europäische Bonds – wie derzeit gefordert – nur zeitlich befristet aufgelegt werden, könnte dies für Deutschland mit Kosten verbunden sein. Diese verblassen jedoch vor den ungleich höheren Kosten einer zweiten Eurokrise: „Wir sind nicht mehr der reiche Norden, wenn der ganze Süden umkippt“, warnte jüngst der ehemalige Präsident der niederländischen Zentralbank, Nout Wellink,[10] und erinnerte damit daran, wie sehr ausgewiesene Handelsnationen wie Deutschland und die Niederlande von einem stabilen Europa abhängen.
Eine gemeinsame Haftung ist daher das Gebot der Stunde. Denn eines steht fest: In diesen harten Zeiten helfen Europa keine technokratischen Kompromisse und keine blumigen Appelle – sondern nur spürbare Solidarität.
[1] Vgl. Karoline Meta Beisel und Björn Finke, Appell vor dem Videogipfel, in: „Süddeutsche Zeitung“, 27.3.2020.
[2] Vgl. Steffen Vogel, Grexit verhindert, Europa verspielt?, in: „Blätter“, 8/2015, S. 5-8.
[3] Vgl. Carlos E. Cué und Bernardo de Miguel, Michel: „¿Tenemos acuerdo, Pedro?” Sánchez: „No. Así es inaceptable.” Así fue la tensa cumbre de la UE, www.elpais.com, 28.3.2020.
[4] Tommy Stubbington, Italian debt sinks after ‚corona bond’ plan falters, www.ft.com, 15.4.2020.
[5] Vgl. Ulrike Herrmann, Tausend Ökonomen gegen Merkel, in: „taz“, 5.4.2020.
[6] Vgl. „Ein Lackmustest für europäische Solidarität“, Interview mit Michael Hüther, www.deutschlandfunk.de, 28.3.2020.
[7] Thomas Fritz, Corona-Krise: Wie deutsche PolitikerInnen den Gesundheitsnotstand in der EU verschärften, www.saveourservices.de, 2.4.2020.
[8] Federico Fubini, Nel gioco delle alleanze europee è Macron che ha la carta decisiva, in: „Corriere della Sera”, 4.4.2020.
[9] Sophie de Ravinel, Le manque de solidarité est un „danger mortel“ pour l’Europe, selon Jacques Delors, www.lefigaro.fr, 28.3.2020.
[10] Martin Visser, Wellink: Italië helpen, of gevaar dat EU uiteenvalt, www.telegraaf.nl, 30.3.2020