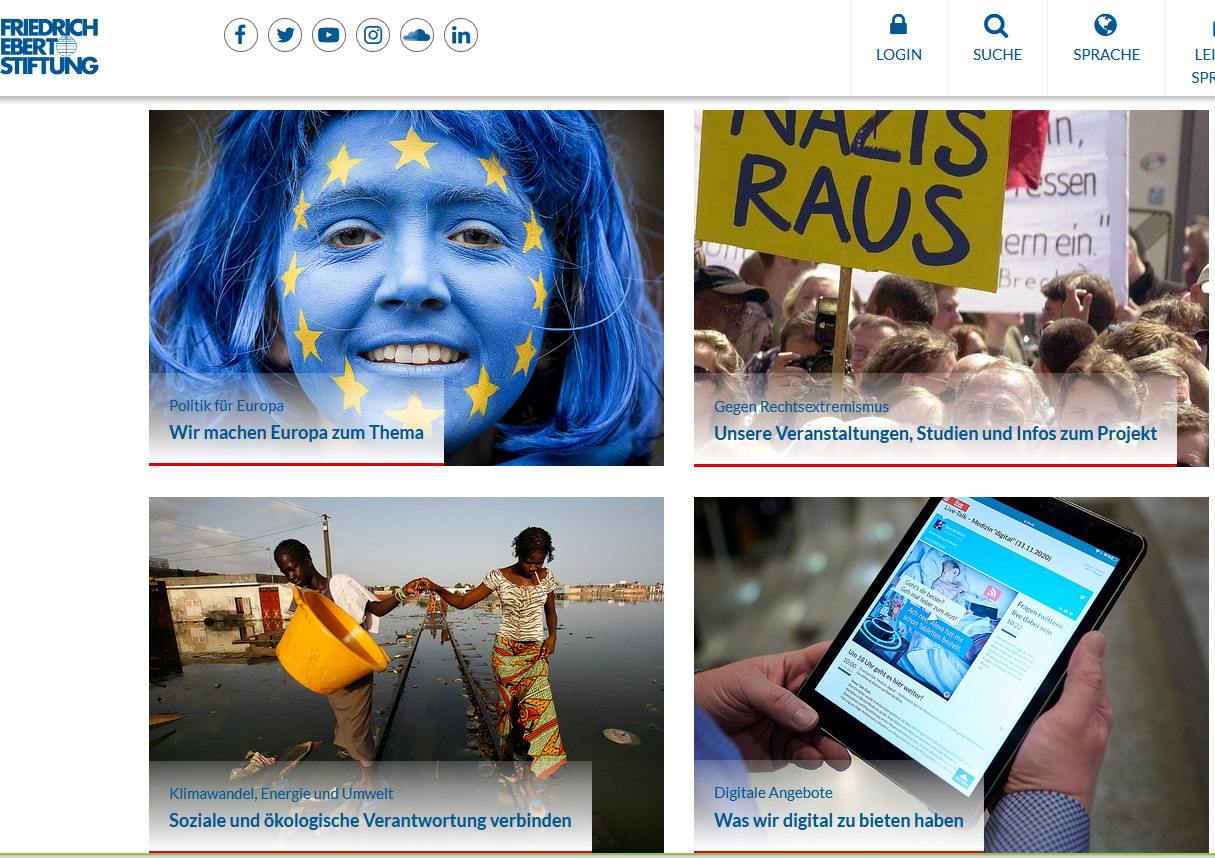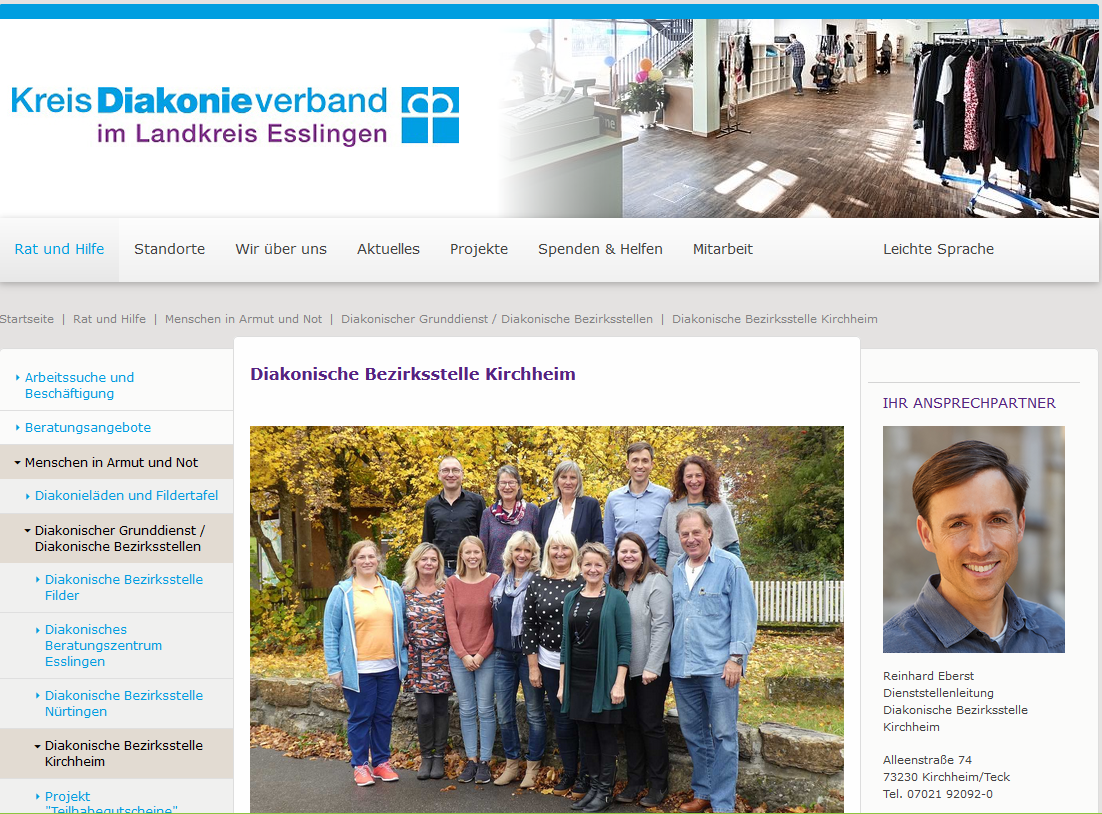Quelle: Wochenzeitschrift „der Freitag“ (Auszug aus dem Artikel)
Aus dem pandemischen Jetzt
Corona: Die einen wollen sofort und um jeden Preis alle vor Covid retten, andere fürchten die Spätfolgen dieses Kurses – ist Verständigung möglich?
Johannes F. Lehmann | Ausgabe 01/2022 27
Politik entscheidet notwendig im Horizont der Gegenwart. Zugleich spielen in der Regel die in der Vergangenheit entwickelten Standards (Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte, Demokratie) und die in der Zukunft liegenden Ziele eine wichtige Rolle. In unserer gegenwärtigen Lage ist dieses Zusammenspiel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachhaltig gestört, wir stehen im Bann der pandemischen Gegenwart. Wo sich vormals Politik auf mittel- oder langfristige Ziele richtete, vollzieht sie sich heute mehrheitlich in einer Art vollständig geschlossenem Gegenwartshorizont.
Dieser Bann in der Gegenwart hat seinen Grund und seine emotionale Rationalität in der schreckerzeugenden Evidenz von gegenwärtigen Todeszahlen und Bildern, von medial herangezoomten täglichen Infektionszahlen und Nationalrankings in den permanent ermittelten Parametern der Pandemie. Derlei Evidenzeffekte erzeugen nicht nur Affekte der Angst und der diffusen Bedrohung im Starren auf die Bilder der uns täglich gezeigten „vollgelaufenen“ Intensivstationen, der viel zu hohen Infektionszahlen und viel zu niedrigen Impfquoten – sie erzeugen auch den Impuls, jetzt zu handeln.
Angesichts so vieler täglich vermeldeter Toter, so vieler Ansteckungen und der immer drohenden (und immer anderswo stattfindenden oder schon vorbereiteten) Triage schlägt der Schrecken um in unbedingten Handlungswillen. Lebensrettung duldet weder Aufschub noch Relativierungen und auch keine Reflexion über mögliche Folgewirkungen. Rettung ist wie die Gefahr immer gegenwärtig. Im Bann der Gegenwart und ihrer Bilder und medialen Echos entsteht bei der Mehrheit der unbedingte Wunsch, möglichst jetzt möglichst hart durchzugreifen, je härter, desto besser. (Eben diese Logik monierte kürzlich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bei seiner Beurteilung der Ausgangssperre im April 2020 als rechtswidrig, denn bei Grundrechtseinschränkung gilt, dass das mildeste mögliche Mittel zu wählen ist.)
Dieser Artikel erschien in Ausgabe 01/2022 vom 06.01.2022 Ihnen gefällt der Artikel? Testen Sie den Freitag jetzt 3 Wochen kostenlos! Hier bestellen!
In gewisser Weise ist die große Bereitschaft zu diesem Handeln, das ja sehr viele Menschen auch massiv schädigt, mit darauf zurückzuführen, dass unter normalen Umständen das politische Handeln weit weniger auf unmittelbare Gegenwartswirkung abzielt. Will man die Rente sicher machen, dann geht es um Zeithorizonte von 20 bis 30 Jahren, will man Fluchtursachen in Afrika bekämpfen, hat man es mit einem sehr komplexen Geflecht von Faktoren auf verschiedensten Ebenen und sehr langen und auch unabsehbaren Entwicklungen zu tun. Die Effekte des politischen Handelns sind hier auch selten unmittelbar zu beobachten oder kausal eindeutig zuzuweisen. Denkt man schließlich an die Bekämpfung der Klimaerwärmung, geht es ebenfalls um sehr lange Zeiträume – und selbst die zeitnahen Ziele wie das Ende von Kohleverstromung oder Verbrennungsmotor greifen erst in zehn bis fünfzehn Jahren.
Handeln – oder sterben?
Es ist angesichts dieser Komplexitäten und Zeitdistanzen eine nachgerade entlastende Erfahrung, das politische Handeln in der Pandemie so sehr in den Bann der Gegenwart gerückt zu sehen. Es gibt plötzlich nur noch eine Bedrohung. Wir kümmern uns nur um die Gegenwart. Die Kausalitäten scheinen zudem für alle offen auf der Hand zu liegen: Lockdown und Kontaktbeschränkung sorgen für die zeitnahe Abflachung der Kurve, die Erhöhung der Impfquote entlastet die Intensivstationen – und all diese an das politische (Maßnahmen) und eigene (Maßnahmeneinhaltung) Handeln geknüpften Effekte werden bereits innerhalb von zwei bis drei Wochen sichtbar.
In diesem Sinn war das eigene politische und persönliche Handeln schon lange nicht mehr so effektiv, so sinnvoll und auch so eindeutig moralisch richtig wie heute. Angesichts der jetzt zu rettenden Leben verbietet sich jede Diskussion. Rettungspolitik immunisiert sich gegen Kritik, schon weil das Gegenteil von Retten Sterben lassen ist.
Dieser Bann im ausschließlichen Blick auf die Gegenwart beschreibt die Position einer „Mehrheit“, der eine „Minderheit“ gegenübersteht. Selbstverständlich ist die Rede von Mehrheit und Minderheit eine überspitzte Modellierung, die nicht exakt die empirische Wirklichkeit erfasst. Dafür sind beide Gruppen viel zu heterogen. Zur Mehrheit gehören sowohl jene, die harte und immer härtere Maßnahmen fordern, als auch die große Menge der Gleichgültigen, die all das mehr oder wenig kritiklos mittragen und sich um mögliche Folgen keine Gedanken machen.
Zur Minderheit gehören am äußersten Rand irrationale Leugner und verbohrte Verschwörungstheoretiker wie aber auch seriöse Kritiker, die aus ihrer Expertise heraus versuchen, andere und auch gänzlich abweichende Perspektiven einzubringen.
Das Entgegensetzen von Mehrheit und Minderheit ist aber deshalb sinnvoll, da sie sichtbar machen kann, dass beide Gruppen unterschiedliche Gegenstände der Sorge haben, die in unterschiedlichen Zeithorizonten liegen.
Die Minderheit – und im Folgenden geht es ausdrücklich nicht um jene, die glauben, Bill Gates wolle uns mit der Impfung Chips implantieren – ist nach dieser Einschätzung dem Bann der Gegenwart nicht in dieser Weise unterworfen.
Die Objekte ihrer Sorge und der Grund für ihre Kritik an der Coronapolitik sind struktureller, mittel- und langfristiger Natur. In der Gegenwart werden hier Prozesse beobachtet, die als mögliche Anfänge und beginnende Zukünfte Angst und Schrecken erzeugen.
Tut man sich einmal im Kreis namhafter Intellektueller und Kritiker der Coronapolitik unter Medizinern, Statistikern, Politikwissenschaftlern, Journalisten, Philosophen, Soziologen, Rechtsanwälten, Verfassungsrechtlern aller Geschlechter um, dann sieht man schnell, dass jenseits des Banns der Gegenwart ganz andere Gegenstände der Sorge diskutiert werden: die Substanz unserer rechtsstaatlichen Prinzipien, die Funktionsfähigkeit öffentlich-rechtlicher Medien, die Unabhängigkeit der Gerichte, die Zukunft der Demokratie, die Rolle von Digitalisierung im Aufbau von Überwachung, die Verstärkung sozialer Ungleichheit durch Schulschließung, die Normalisierung der Bindung von Zutrittsrechten an Gesundheitspässe und Kontrollen, die Erosion grundrechtlicher Prinzipien der Gleichbehandlung von Menschen, wenn die Antidiskriminierungsstelle der Bundesregierung ausdrücklich Diskriminierung von Ungeimpften erlaubt.
Gleichsam abgewandt von den Bildern der Intensivstationen debattieren diese Kritiker die möglichen kurz-, mittel- und langfristigen medizinischen, sozialen und politischen Folgen der Pandemiepolitik, wobei die Struktur der Debatte selbst ein wichtiges Feld der Sorge darstellt.
Denn derart abgewandt vom Bann-Blick auf die Coronatoten und die Intensivstationen erscheinen diese Kritiker der Mehrheit schnell als Coronaleugner, als Verharmloser, Schwurbler oder Querdenker. Und zwar schon deshalb, weil sie in ihrer Diskussion nicht im Bann der Gegenwart stehen und deren Horizontschließung mit ihren Sorgen um strukturelle und zukünftige Entwicklungen sprengen. Aus der Perspektive des Gebannten kann aber die Tatsache, nicht vom Schrecken der Krankenhausbilder und der Infektionszahlen gebannt zu sein, nur bedeuten, die eigentliche Gefahr zu leugnen oder zu verharmlosen.
Johannes F. Lehmann ist Professor für Neuere deutsche Literatur- und Kulturwissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn