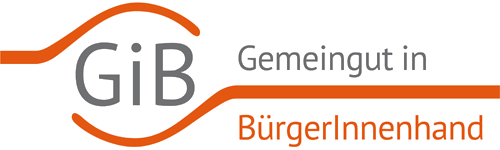Quelle: Website Rosa-Luxemburg-Stiftung
Ja zur Vergesellschaftung Was kann Artikel 15 Grundgesetz?
Warum Vergesellschaftung verfassungsrechtlich zumindest kein Problem ist
AUTOR/INNEN: Franziska Drohsel, Cara Röhner, Barbara Fried, Armin Kuhn
Franziska Drohsel und Cara Röhner im Interview. Das Gespräch führten Barbara Fried und Armin Kuhn.
Dem Volksentscheid von Deutsche Wohnen & Co. enteignen (DWE) haben im September 2021 fast 60 Prozent der Berliner Wähler*innen zugestimmt. Er sieht vor, erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik den Artikel 15 Grundgesetz (GG) zur Anwendung zu bringen und große Wohnungsbestände von privaten Unternehmen zu vergesellschaften. Was genau besagt dieser Artikel?
Franziska: Artikel 15 Grundgesetz besagt, dass «Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel […] in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden» können. Das heißt, das Grundgesetz sieht ausdrücklich vor, dass bestimmte Bereiche unserer Wirtschaft dem Markt entzogen, also vergesellschaftet, gemeinwirtschaftlich organisiert und demokratisch verwaltet werden können, sofern der Gesetzgeber das beschließt.
Wie kam es dazu?
Franziska: Bei der Entstehung des Grundgesetzes in den Jahren 1948/49 war der Artikel durchaus umstritten. Für die Sozialdemokratie war er allerdings entscheidend. Sie hat ihre Zustimmung zur Verfassung daran geknüpft. Später hat das Bundesverfassungsgericht von einer «wirtschaftspolitischen Neutralität» des Grundgesetzes gesprochen. Das bedeutet, dass unsere Verfassung hinsichtlich der Wirtschaftsordnung insofern keine Vorgaben macht, als eine kapitalistische Marktwirtschaft darin nicht festgeschrieben ist. In der Geschichte der BRD gab es ja auch lange Zeit Bereiche wie die Bundespost oder die Bahn, die dem Markt entzogen waren. Das wäre heute auch für andere Bereiche denkbar.
Dieses Interview erscheint in der LuXemburg-Ausgabe 1-2022 «Besitz Ergreifen».
ür welche zum Beispiel?
Cara: Die im Artikel genannten Güter – «Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel» – sind solche, die für die wirtschaftliche Organisierung einer Gesellschaft zentral sind. Gerade weil sie so elementar sind, sollen sie sozialisierungsfähig sein und per Gesetz der Verfügungsmacht privater Eigentümer*innen entzogen werden können. Im Kern geht es um die Demokratisierung der Wirtschaft dadurch, dass eine gesellschaftliche Verfügungsmacht über zentrale Güter und Ressourcen hergestellt wird.
Die IG Metall hat in den 1980er Jahren mal einen gescheiterten Vorstoß zur Vergesellschaftung der Stahlindustrie gestartet. Warum ist der Artikel 15 noch nie zur Anwendung gekommen?
Cara: Bei der Entstehung des Grundgesetzes war es das Fernziel der Sozialdemokratie, den demokratischen Sozialismus per Gesetz einführen zu können – das war etwas legalistisch gedacht, aber genau diese Möglichkeit sollte mit Artikel 15 GG offengehalten werden. Doch dann drehte sich der Wind: Der Ost-West-Konflikt, das sogenannte Wirtschaftswunder, der Ausbau des Sozialstaats und die tarifpolitischen Erfolge der Gewerkschaften führten zu einer Situation, in der Forderungen nach Vergesellschaftung keine politische Zugkraft mehr hatten. Später, im Neoliberalismus, kam das Dogma der Privatisierung hinzu. In diesem Kontext war Vergesellschaftung, etwa als Krisenlösung für die Stahlindustrie, nicht mehr denkbar.
Warum hat sich das jetzt geändert?
Cara: Es ist interessant, dass die Debatte zu einem Zeitpunkt wieder relevant wird, an dem sich gesellschaftliche Krisen zuspitzen. Vergesellschaftung wurde erstmals wieder während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 politisch diskutiert. Dabei sollte es aber um die Rettung der Banken gehen – Vergesellschaftung also als verfassungsrechtliches Mittel zur Rettung des Kapitalismus. Genau das ist aber nicht Sinn und Zweck von Artikel 15 GG. Die aktuelle Wohnungskrise hat nun dazu geführt, sich zivilgesellschaftlich auf Artikel 15 GG zurückzubesinnen. Der Leidensdruck in den Städten ist derart hoch, dass die Menschen Wohnen anders organisieren wollen und auch erkennen, dass dies über die Vergesellschaftung gemeinsam erreicht werden kann. Hier sehe ich eine echte Chance.
Wie steht es denn mit Artikel 14 GG? Danach wird ja ständig enteignet – aktuell laufen allein 140 Verfahren im Zusammenhang mit dem Autobahnbau. Was ist verfassungsrechtlich der Unterschied?
Franziska: Die beiden Artikel sind eigentlich gar nicht vergleichbar. Während es bei Artikel 15 darum geht, wie zentrale Wirtschaftsbereiche gesellschaftlich zu organisieren sind, geht es bei Artikel 14 darum, Grundrechtspositionen von Einzelnen zu schützen. Menschen sollen beispielsweise davor geschützt werden, ihr Zuhause zu verlieren, weil Kohle abgebaggert oder eine Autobahn gebaut werden soll. Ein solcher Eingriff in privates Eigentum muss gerechtfertigt sein, ist nur zum Wohle der Allgemeinheit möglich und muss entschädigt werden. Bei Artikel 14 geht es also um ein Abwehrrecht gegen staatliches Handeln.
Cara: Bei einer Vergesellschaftung, wie sie DWE fordert, steht etwas anderes zur Diskussion: Die Wohnungsbestände großer – börsennotierter – Immobilienkonzerne sollen entprivatisiert werden. Hier geht es um die demokratische Transformation des Wohnungsmarktes zugunsten der Mieter*innen. Insofern lässt sich Artikel 15 als kollektives Grundrecht der Vielen auf Entprivatisierung beschreiben. Von seiner Zielrichtung her unterscheidet sich das von einem individuellen Abwehrrecht. Durch Vergesellschaftung müssen die Immobilienkonzerne ihre Gewinnchancen für die Zukunft schmälern und es kann durchaus sein, dass auch Kleinaktionär*innen davon betroffen sind, das ist so. Aber dafür bedeutet eine gemeinwirtschaftliche Organisierung des Wohnens, dass die große Mehrheit der Menschen Freiheiten gewinnt. Dieser Punkt wird bisher in der Debatte viel zu wenig betont.
Wie sieht es konkret mit Blick auf den Volksentscheid aus? Die neue Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hält das Anliegen für verfassungswidrig. Eine strittige Frage dabei ist, ob der Artikel 15 in Berlin überhaupt anwendbar ist, da Vergesellschaftung in der Landesverfassung nicht vorgesehen ist. Wie seht ihr das?
Franziska: Für die Überführung von Grund und Boden in Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft besteht eine konkurrierende Gesetzgebung. Da der Bund von Artikel 15 bisher keinen Gebrauch gemacht hat, kann der Landesgesetzgeber tätig werden. Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum der Eigentumsschutz in der Berliner Landesverfassung weitergehen soll, als im Grundgesetz. Außerdem bricht Bundesrecht Landesrecht.
Cara: Ich halte das auch für eine Nebelkerze. Das Schweigen einer Landesverfassung kann die wirtschaftliche Öffnungsklausel im Grundgesetz nicht aushebeln. Der Einwand zeigt eher, dass die Gegner*innen wenige gute Argumente haben.
Ein anderes Argument ist, dass eine Vergesellschaftung nur dann zulässig sei, wenn alle anderen Mittel versagt haben – nur als Ultima Ratio. Kann also nur vergesellschaftet werden, wenn alle anderen Mittel, um bezahlbaren Wohnraum zu erhalten, ausgeschöpft sind?
Cara: Ob ein Gesetz verhältnismäßig ist, ist fester Bestandteil jeder verfassungsrechtlichen Prüfung. Der Staat darf nur so weit in individuelle Freiheit eingreifen, wie es unbedingt nötig ist. Aber bei der Vergesellschaftung geht es darum eben nicht, sondern um die Einführung einer anderen Form des Wirtschaftens – um eine Demokratisierung und entsprechend um einen Freiheitsgewinn für die Vielen. Vergesellschaftung ist also keine Ultima Ratio, sondern eine durch die Verfassung legitimierte, demokratische Entscheidung für gemeinwirtschaftliche Eigentums- und Wirtschaftsformen. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen: Wenn der Gesetzgeber es will, dann kann er vergesellschaften. Punkt. Er muss lediglich angemessen entschädigen.
Franziska: Ja, der Gesetzgeber muss entscheiden, ob eine Vergesellschaftung zweckmäßig ist. Es lässt sich gut argumentieren, dass der Zweck in der Überführung eines Teils der Wohnungswirtschaft in eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung liegt. Und dafür gibt es kein besseres Mittel als die Vergesellschaftung.
Lässt man sich hilfsweise darauf ein, die die Verhältnismäßigkeit zu diskutieren, gibt es meines Erachtens auch hierfür überzeugende Argumente. Verhältnismäßigkeit ist gegeben, wenn die Maßnahme einem legitimen Ziel dient und zur Erreichung dieses Ziels geeignet, erforderlich und angemessen ist. Das Ziel, auch für Menschen mit geringem Einkommen angemessenen Wohnraum zu schaffen, findet sich in Artikel 28 der Berliner Verfassung. Trotz verschiedener Versuche, den Mietmarkt zu entspannen, steigen die Mieten aber weiter und ärmere Menschen werden aus den Innenstadtbereichen verdrängt. Vor diesem Hintergrund lässt sich gut argumentieren, warum eine Vergesellschaftung von Wohnraum nicht nur sehr geeignet, sondern auch erforderlich und angemessen ist.
Ihr habt beide betont, dass das Ziel der Vergesellschaftung die demokratische Transformation des Kapitalismus ist. Wie lässt sich dann die Grenze von 3 000 Wohnungen im Bestand eines Wohnungsunternehmens begründen? Oft ist dann von «Sozialisierungsreife» die Rede.
Cara: Die Diskussion um eine Sozialisierungsreife hat ihren historischen Ursprung darin, dass bei einer Vergesellschaftung von Industrie oder Landwirtschaft nicht etwa Kleinstbetriebe mit einigen wenigen Mitarbeiter*innen das Ziel waren, sondern große Wirtschaftseinheiten. Auf Wohnungen übertragen wäre also die Frage, ob auch das Haus der Oma vergesellschaftet werden dürfte. Die Frage stellt sich aber gar nicht, weil die Initiative bewusst gesagt hat, dass es nur um die Bestände großer Wohnungskonzerne gehen soll.
Franziska: Die Frage der Sozialisierungsreife, also ob ein Gut eine gewisse wirtschaftliche Relevanz haben muss, um vergesellschaftet werden zu können, ist durchaus umstritten. Allerdings wäre diese Voraussetzung bei der hier vorgeschlagenen Grenze von 3 000 Wohnungen in meinen Augen erfüllt. Nach aktuellen Schätzungen dürften etwa 10 bis 15 Prozent des Wohnungsbestandes in Berlin betroffen sein – da kann man schon von einer gewissen wirtschaftlichen Bedeutung sprechen.
Und wie steht es mit den Genossenschaften? Manche behaupten, dass auch sie unter ein Vergesellschaftungsgesetz fallen würden.
Cara: Das Grundgesetz sagt, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden muss. Verfassungsrechtlich braucht eine Ungleichbehandlung also einen guten Grund, der im Falle der Genossenschaften gegeben ist: Sie sind bereits demokratisch verfasst und haben das Ziel, ihre Mitglieder mit Wohnraum zu versorgen, und zwar nicht gewinnorientiert, sondern zu einer kostendeckenden Miete. Hier liegt der relevante Unterschied zu den privaten Wohnungskonzernen, die Gewinne für ihre Aktionär*innen erwirtschaften wollen.
Franziska: Der Gesetzentwurf der Initiative hat die Genossenschaften explizit ausgenommen, da diese ja bereits gemeinwirtschaftlich organisiert sind. Sie unterscheiden sich von profitorientierten Unternehmen, da sie ihren Mitgliedern gehören und ihr Hauptzweck eben nicht der Profit ist.
Wie ist diese Überführung in Gemeinwirtschaft verfassungsrechtlich zu bestimmen?
Franziska: Artikel 15 GG setzt die Überführung in Gemeineigentum oder Gemeinwirtschaft, also eine neue rechtliche Ordnung voraus. Was DWE vorschlägt, ist etwas grundlegend Neues, und wie das genau aussehen kann, muss natürlich entwickelt und diskutiert werden. Die Idee der Initiative, dafür eine Anstalt öffentlichen Rechts zu schaffen, in der Belegschaft, Mieter*innen und Stadtgesellschaft an den Entscheidungen beteiligt sind, finde ich sehr überzeugend (vgl. Hamann/Demirovic in der LuXemburg-Ausgabe 1-2022 «Besitz Ergreifen»).
Eine strittige Frage ist logischerweise die Höhe der Entschädigung. An welchen rechtlichen Anhaltspunkten könnte sich der Gesetzgeber orientieren?
Franziska: Klar ist, dass «Art und Ausmaß der Entschädigung» geregelt werden müssen – so steht es im Grundgesetz. Aber selbst bei Artikel 14 GG hat das Bundesverfassungsgericht festgehalten, dass weder eine einmalige Zahlung noch eine Orientierung am Marktwert zwangsläufig ist. Eine Vergesellschaftung dann nur unter Marktgesichtspunkten, also nur nach Verkehrswert zuzulassen, würde ja den Zweck konterkariert. Mit ihrem Faire-Mieten-Modell hat die Initiative einen guten Vorschlag gemacht, der politisch und rechtlich ausführlich diskutiert werden sollte.
Cara: Im Grundgesetz heißt es ja außerdem «unter gerechter Abwägung der Interessen». Diese Abwägung liegt beim Gesetzgeber, der eine politische Entscheidung treffen muss, die nicht offensichtlich ungerecht sein darf. Es ist aber vollkommen klar, dass eine Familie, deren Eigenheim zugunsten des Kohleabbaus enteignet wird, anders entschädigt werden muss als ein DAX-Unternehmen. Für die Aktionär*innen bedeuten geminderte Gewinnchancen eine weniger existenzielle Beeinträchtigung. Der Berliner Senat wird über die Höhe der Entschädigung also politisch befinden müssen und entscheiden, was er unter Abwägung verschiedener Motive und Belange als gerecht betrachtet. Er darf sich dafür entscheiden, den Maximalpreis zu zahlen, er darf aber auch ein anderes, nachvollziehbares Modell wählen, indem er etwa auf die Vorschläge der Initiative oder des Frankfurter Professors Fabian Thiel zurückgreift (vgl. Kuhn in der LuXemburg-Ausgabe 1-2022 «Besitz Ergreifen»).
Ein Vergesellschaftungsgesetz wird wohl in jedem Fall vor Gericht verhandelt werden. Wenn es verfassungsrechtlich kaum Anhaltspunkte gibt, was haben wir dann zu erwarten?
Cara: Jurist*innen sagen immer, vor Gericht oder auf See sei man in Gottes Hand. Zur Frage der Entschädigung muss der Gesetzgeber seine Entscheidung plausibel begründen und seine Motive schlüssig darlegen. Dass die Entscheidung eine politische ist, werden aber auch die Gerichte anerkennen.
Franziska: Das ist der entscheidende Punkt. In der Diskussion wird oft so getan, als gäbe es keinen Spielraum, etwa wenn behauptet wird, es gehe zwingend um eine Einmalzahlung in astronomischer Höhe. Das halte ich für äußerst problematisch.
Cara: Ja, es führt auch die Bürger*innen in die Irre. Nach dem ablehnenden Urteil zum Mietendeckel verstehe ich die Vorsicht, aber die Spielräume sind im Falle der Vergesellschaftung deutlich größer und die Risiken geringer. Die Chance, hier aktiv zu gestalten und auch rechtlich Neuland zu betreten, sollte das Land Berlin nutzen.
Genau wegen des gescheiterten Mietendeckels machen sich viele Mieter*innen Sorgen, dass die Vergesellschaftung zwar ein originelles, aber ähnlich ›gewagtes‹ Projekt ist und womöglich keinen Bestand haben wird. Wie kann es gelingen, das Vorhaben wasserdicht zu machen?
Cara: Wasserdicht wird das nicht möglich sein – schon weil es keine Präzedenzfälle gibt. Wichtig wird eine gute und detaillierte Gesetzesbegründung sein, die die Abwägungen bei der Entschädigung akribisch darlegt und sich auch mit Gegenargumenten auseinandersetzt.
Franziska: Die Idee, eine Expert*innenkommission einzusetzen mit viel Sachverstand aus mehreren Disziplinen, in der vielleicht auch ehemalige Verfassungsrichter*innen sitzen – das kann schon der richtige Ansatz sein. Sie darf nur nicht dazu genutzt werden, eine mit großer Mehrheit getroffene Entscheidung zu verschleppen.
Cara: Genau, die Umsetzung durch eine lange Prüfung der Verfassungsmäßigkeit hinauszuzögern, wäre fatal. Der Volksentscheid hat den politischen Willen auf beeindruckende Weise demonstriert. Diese demokratische Entscheidung zu ignorieren, stünde einer rot-grün-roten Regierung sehr schlecht zu Gesicht. Das könnte auch ein neues Einfallstor für Rechtspopulismus bieten.
Franziska Drohsel ist Rechtsanwältin und arbeitet als juristische Referentin in der Beratung von Betroffenen sexualisierter Gewalt. Zwischen 2007 und 2010 war sie Bundesvorsitzende der Jusos in der SPD.
Cara Röhner lehrt Jura an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Verfassungs-, Sozial- und Antidiskriminierungsrecht, soziale Ungleichheitsverhältnisse und Vergesellschaftung. Zuvor war sie als Juristin und Referentin für Sozialrecht bei der IG Metall tätig.
Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages (2019)
Zur Vergesellschaftung eines privatwirtschaftlichen
Wohnungsunternehmens nach Art. 15 GG