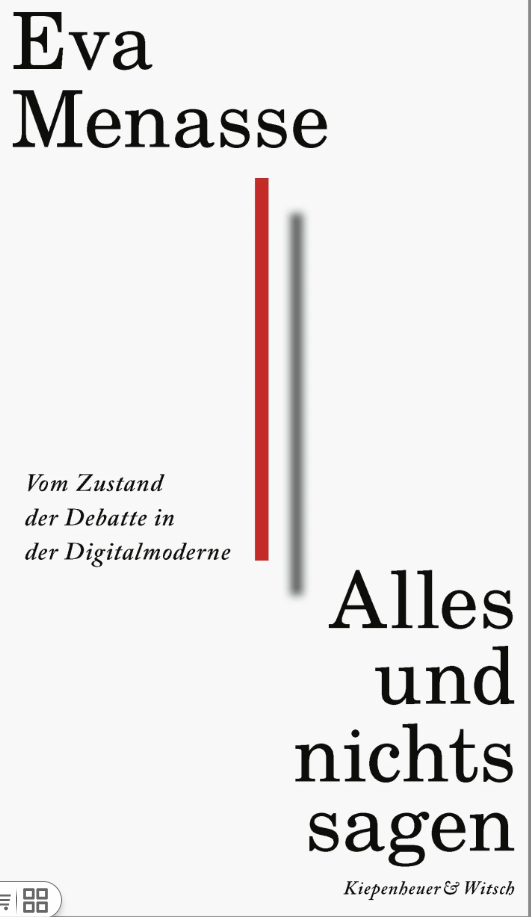Die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse ist besorgt: Im Kontext der Debatte um den Gazakrieg sage man lieber nichts mehr über Israel, statt sich den Mund zu verbrennen. Diese Duckmäuserei führe aber nicht zu politischem Fortschritt, sondern zum Zerfall der Öffentlichkeit.
Themen in dieser Folge: 00:00 Was hat es mit dem Bekenntniszwang auf sich? 12:20 Wäre eine Welt ohne Social Media besser? 17:41 Was waren die Vorwürfe an den PEN Berlin bezüglich des Gaza-Krieges? 25:29 Warum Menasse von Kultur-Boykotten nichts hält 47:03 Warum linke Symbolpolitik den Antisemitismus nicht bekämpft Die Klage über das vergiftete Diskursklima gehört mittlerweile zum Grundbestand der Gegenwartsdiagnosen.
Auch die vielfach preisgekrönte Bestsellerautorin Eva Menasse zeigt sich besorgt und warnt vor der Fragmentierung des öffentlichen Raums in einer Digitalmoderne, die von «Brachialvereinfachung» und «Hetzmeuten» dominiert sei.
Als eine der Sprecherinnen des PEN Berlin ist sie insbesondere um die Kunst- und Meinungsfreiheit besorgt. Aberkannte Preise, abgesagte Ausstellungen und ausgeladene Gäste würden auf den ersten Blick das beruhigende Gefühl vermitteln, etwas gegen Antisemitismus, Rassismus oder Transfeindlichkeit getan zu haben. Gegen die Polarisierung bringe das jedoch nichts – im Gegenteil. Vielmehr sieht sie darin einen Bekenntniszwang am Werk, der Ausdruck sei des «würgenden Wunsches, auf der garantiert richtigen Seite zu stehen». Das Resultat: Symbol- statt Sachpolitik. Aber wo verlaufen die Grenzen der Redefreiheit? Und was lässt Menschen einander so missverstehen? Barbara Bleisch hakt nach. Sternstunde Philosophie vom 31.03.2024
Anmerkungen (H.D.): Eva Menasse hat im Kiepenheuer&Witsch-Verlag das Buch „Alles und nichts sagen. Vom Zustand der Debatte in der Digitalmodere“ publiziert. (s. Leseprobe). In diesem Buch geht sie auch auf den amerikanischen Linguisten John McWhorter und sein Buch „Woke Racism“ ein. McWhorters ist 2022 in einer deutschen Ausgabe mit dem Titel „Die Erwählten: Wie der neue Antirassismus die Gesellschaft spaltet“ erschienen.
Auszug aus einer Rezension im Deutschlandfunk:
„Die Erwählten“, im Original: Woke Racism, versteht sich als Streitschrift – polemisch, provokant, mit steilen Thesen, messerscharf beobachtet und geschrieben in einer geschliffenen Sprache, die Kirsten Riesselmann furios ins Deutsche übertragen hat. McWhorter spricht von der Dritten Welle des Antirassismus. Im US-Fernsehen erklärt er: „Die erste Welle kämpfte gegen die Rassentrennung und für das Wahlrecht von Afroamerikanern. Die zweite Welle – in den 1970er- und 1980er- Jahren – ging gegen rassistische Vorurteile vor, mit gemischtem Erfolg. Die dritte Welle des Antirassismus fordert von weißen Amerikanern das lebenslange Bewusstsein für ihre Komplizenschaft, für ihre sogenannte weiße Schuld und ihre weißen Privilegien. Die neuen Antirassisten sind überzeugt: Solange dieser Erziehungsauftrag nicht erfüllt ist, kann es keinen Fortschritt für das schwarze Amerika geben.“
Getrieben werde diese aktuelle Welle vor allem von linksliberalen Weißen, die sich zu Rettern schwarzer Menschen erklärten – eine Haltung, die zutiefst herablassend sei, findet McWhorter, und damit im Kern selbst rassistisch. Seine These: Der neue Antirassismus ist eine Religion. Und seine Anhänger? „Wir müssen diese Menschen sehen als das, was sie sind: Mitglieder einer Sekte, religiöse Fundamentalisten und Fundamentalistinnen“.
Der Atheist McWhorter nennt sie „Die Erwählten“. Sie seien missionarisch, anti-aufklärerisch, intolerant. Sie kultivierten eine Aura der moralischen Überlegenheit, predigten die ritualisiere Buße, praktizierten das Wechselspiel aus Angst und Demut. Der Rassismus-Vorwurf – oder allein die Drohung damit – werde zur wirksamen Waffe.“
Giovanni di Lorenzo im Gespräch mit Eva Menasse | Die Lange Nacht der ZEIT 2022 58.090Aufrufe 25. Juli 2022
Der ZEIT-Chefredakteur hat mit der Bestsellerautorin über ihre Literatur gesprochen und darüber, warum die gebürtige Wienerin seit 20 Jahren in Berlin lebt. Die Lange Nacht der ZEIT ist zurück! Endlich konnten wir Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wieder in großer Zahl vor Ort begrüßen und die schönsten Bühnen Hamburgs bespielen – vom Mojo Club bis zum SchauSpielHaus, mit einer Liveaufzeichnung unseres Podcasts »ZEIT Verbrechen«, einem Gespräch mit Robert Habeck über die Zukunft der Energieversorgung und vielem mehr. Die Lange Nacht der ZEIT war erstmalig durch ein Zukunftsfestival ergänzt, das wir gemeinsam mit der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und THE NEW INSTITUTE organisiert haben. Mit jungen Politikerinnen, Aktivisten, ZEIT-Autorinnen und -Autoren haben Sie über die Zukunft der Zivilgesellschaft und der Ökologie, des Sozialstaates und der Demokratie diskutiert. Wir danken Ihnen für ihre zahlreiche Teilnahme! Ausgewählte Programmpunkte können Sie hier als Aufzeichnungen aus den Livestreams anschauen.